Autoren: Christine Resch und Stefan Resch
Bestimmungsmerkmale
- 8–11 cm Körperlänge, dunkelgrauer Rücken und weißgrauer Bauch
- Schwarze Gesichtsmaske von der Oberlippe bis unter die Ohren
- Der Schwanz ist dicht behaart und wird gegen Ende hin leicht buschig
Lebensraum
Der Baumschläfer bewohnt ein breites Spektrum an verschiedenen Waldlebensräumen. Dies reicht von feucht-schattigen Laubmischwäldern mit dichtem Unterwuchs in Tallagen bis zu strukturreichen Nadelwäldern im Bereich der Waldgrenze. In den Alpen ist er meist in feuchten Habitaten mit Fichten- und Buchenbeständen beheimatet. Insgesamt zählen im Bergland Fichten-TannenBuchenwälder, Fichten-Buchenwälder und Lärchen-Fichtenwälder zu den Lebensräumen des Baumschläfers. Aufgrund seiner Präferenz zu Laubbeständen mit hoher Bodenfeuchtigkeit und dichter Krautschicht bevorzugt er oft Standorte entlang von Gewässern oder Feuchthängen. Hier findet er in den strauchreichen Grauerlenwäldern Deckung und Nahrung. Da der tierische Anteil in seiner Ernährung hoch ist, ist er im Vergleich zu Haselmaus und Siebenschläfer weniger an Früchte und Samen von Gehölzen gebunden. Dementsprechend häufiger bewohnt er auch Nadelwälder.
Lebensweise
Der ortstreue und stimmfreudige Baumschläfer ist ein vorwiegend nachtaktiver Bilch, zeigt aber nach dem Winterschlaf sowie im Herbst vermehrte Tagaktivität. Der Baumschläfer lebt als territorialer Einzelgänger in einem rund 1 Hektar (Weibchen) und 3 Hektar (Männchen) großen Revier. Er baut freistehende Nester oder legt diese in Baumhöhlen an. Es ist nur wenig über sein bevorzugten Nestmaterial bekannt. In unserem Projekt bestehen die Nester in den Nistkästen vorwiegend aus Moos, Flechten und Lärchennadeln. Den Winterschlaf verbringt er von Ende September bis April/Mai in frostfreien Erdverstecken, welche meist in einer Tiefe von 30–60 cm unter Baumwurzeln liegen. Nach dem Winterschlaf beginnt die Fortpflanzungszeit und nach einer Tragzeit von einem Monat werden 3–5 Jungtiere geboren. Die jungen Baumschläfer leben bis zum Herbst in Gruppen. Über die Ernährung des Baumschläfers in den Alpen ist nur wenig bekannt. Studien aus Polen (Nowakowski & Godlewska, 2006.) und Litauen (Juškaitis & Baltrūnaitė, 2013). legen nahe, dass der Baumschläfer saisonale Nahrungspräferenzen hat: Während er im Sommer vorwiegend pflanzliche Kost zu sich nimmt, frisst er im Frühjahr und Herbst hauptsächlich wirbellose Tiere wie Käfer und Tausendfüßler. Ob dies auch für den Alpenraum zutrifft und welche Nahrung der Baumschläfer im Detail bevorzugt, wird im Rahmen des Projekts erforscht.
Verbreitung in Nordtirol
Die wenigen Nachweise des Baumschläfers in Nordtirol lassen darauf schließen, dass der kleine Bilch hier selten ist. Nach 1970 beschränken sich bekannte Vorkommen auf das Radurschltal und das Ötztal (Schedl 1968; Spitzenberger 1983, 2001). Ältere Nachweise aus der Umgebung von Innsbruck konnten bis heute nicht bestätigt werden. Im Rahmen des Interreg-Projekts „Der Baumschläfer Dryomys nitedula im Rätischen Dreieck“ gelangen erstmals wieder aktuelle Nachweise des Bilchs. Diese stammen aus Gries im Sellrain, der Oberbödenalm bei Ginzling, Längenfeld und Piburg und belegen, dass der Baumschläfer noch in Nordtirol beheimatet ist.
Verbreitung in Südtirol (Eva Ladurner)
Der Baumschläfer ist aus ganz Südtirol bekannt, der Verbreitungsschwerpunkt liegt aber klar im Osten des Landes. Er besiedelt verschiedenste Waldlebensräume zwischen 800 m und 2.200 m, wird in den höheren Lagen aber auch immer wieder aus Jäger-Hochsitzen und Almhütten gemeldet. Der Baumschläfer konnte Anfang der 2000er Jahre nach fast hundert Jahren am Ritten erstmals wieder in Südtirol nachgewiesen werden (Ladurner & Cazzolli 2002). Seitdem kommt es regelmäßig zu Beobachtungen im Rahmen von Forschungsprojekten, aber auch immer wieder zu Meldungen aus der Bevölkerung. Mittlerweile sind in Südtirol Zufallsfunde vom Baumschläfer häufiger als jene vom Gartenschläfer.
Quellen
Naturkundliche Verbreitungsdatenbank von Südtirol (Naturmuseum Südtirol & Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung – Autonome Provinz Bozen [Dezember 2024]) Juškaitis, R. & L. Baltrūnaitė. (2013): Seasonal variability in the diet of the forest dormouse, Dryomys nitedula, on the north-western edge of its distributional range. Folia Zoologica 62: 311-318. Ladurner, E. & N. Cazzolli (2002): Kleinsäuger-Erhebung am Ritten (Südtirol, Italien): Artenspektrum, Habitatnutzung, Kletterverhalten. Gredleriana 2: 183-204. Nowakowski, W. K. & M. Godlewska. (2006): The importance of animal food for Dryomys nitedula Pallas and Glis glis l. in Białowieża Forest (East Poland): Analysis of faeces. Polish Journal of Ecology 54: 359-367. Schedl, W. (1968): Der Tiroler Baumschläfer (Nitedula intermedius [Nehring, 1902]) (Rodentia, Muscardinidae). Ein Beitrag zur Kenntnis seiner Verbreitung und Ökologie. Berichte des Naturwissenschaftlich-Medizinischen Vereins in Innsbruck 56: 389-406. Spitzenberger, F. (1983): Die Schläfer (Gliridae) Österreichs. Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum (Mammalia austriaca 6) 30: 19-64. Spitzenberger, F. (2001): Die Säugetierfauna Österreichs. Austria Medien Service, Graz.
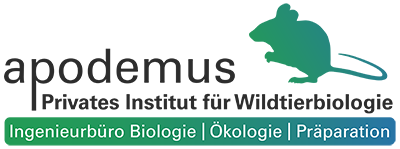


 °C
°C





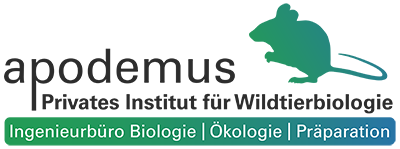
 Steckbrief Baumschläfer
Steckbrief Baumschläfer















